Deutsch als Fremdsprache
Buchtipps
- Christoph Hein: Alles, was du brauchst (Buchtipp von Alexandra Hausner)
- Iris Wolff. Die Unschärfe der Welt (Buchtipp von Alexandra Hausner)
- Uwe Timm. Morenga (Buchtipp von Alexandra Hausner)
- Peter Henisch: Suchbild mit Katze (Buchtipp von Irmgard Soukup-Unterweger)
Buchtipp von Alexandra Hausner:¹
Alles, was du brauchst (von Christoph Hein)
Hanser, München 2019, 86 Seiten
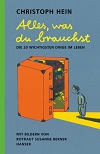
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/alles-was-du-brauchst/978-3-446-26273-7/
Christoph Hein (*1944) kennen wir vor allem durch seine wunderbaren Romane wie Der fremde Freund, Der Tangospieler, Landnahme, Glückskind mit Vater oder Trutz. Heute möchte ich sein Kinderbuch Alles, was du brauchst empfehlen. Liebevoll und feinsinnig von Rotraut Susanne Berger illustriert lässt es sich wunderbar im Unterricht einsetzen. Wie der Titel schon sagt, geht es um das, was im Leben zählt und glücklich macht. In den kurzen 20 bebilderten Texten (1-2 Seiten) erzählt Hein von Freund*innen, Geschwistern, Zimmern, Lieblingsgeschichten, -gerichten und -kleidern, Familie, Gefühlen und unserer Erde. Sie bieten motivierende Einstiege und Gesprächsanlässe zu existentiellen Themen und lassen sich kreativ bearbeiten und weiterentwickeln. Sie inspirieren und berühren, da Heins Geschichten jedem von uns etwas zu sagen haben.
¹ Alexandra Hausner lebt in Turin und arbeitet am dortigen Goethe-Institut. Bis 2021 unterrichtete sie auch Deutsch als Fremdsprache an der Universität Turin.
---
Buchtipp von Alexandra Hausner:
Iris Wolff. Die Unschärfe der Welt
Klett-Cotta, Stuttgart 2020. 213 Seiten
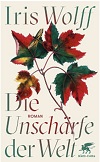
https://www.klett-cotta.de/buch/Gegenwartsliteratur/Die_Unschaerfe_der_Welt/117319
Eines der schönsten Bücher der letzten Zeit war für mich Die Unschärfe der Welt von Iris Wolff (*1977 in Hermannstadt). Der Roman spielt in Siebenbürgen, im Banat und in der Bundesrepublik und umfasst den Zeitraum von König Michael bis zu den Jahren nach dem Zusammenbruch des Regimes von Ceauscescu. In sieben Geschichten wird jeweils aus der Perspektive einer der aus vier Generationen stammenden Hauptfiguren erzählt, die unter den wechselnden politischen Verhältnissen nach ihrer Identität und ihren Lebenszielen suchen und sich zu behaupten versuchen. Von Kapitel zu Kapitel entdeckt man als Lesender die Verbindungen der Schicksale der Protagonist*innen (man kann die Geschichten aber auch einzeln lesen). Doch sind es nicht nur die politischen Ereignisse, die das Leben der Figuren bestimmen, sondern vor allem die Landschaften, das dörfliche Leben, die Naturgewalten im Wechsel der Jahreszeiten. Wunderschön Wolffs ruhige, unaufgeregte und lyrische Sprache, mit der sie ihre präzisen und bildreichen Sätze formt. Es handelt sich um ihren vierten Roman, der auf der Longlist des deutschen Buchpreises (2020) stand. Die Autorin, die mit ihren Romanen das Schicksal und das Leben der Rumäniendeutschen in den Mittelpunkt stellt, ist selbst 1985 in die Bundesrepublik ausgewandert. Doch ist ihr Blick im Gegensatz zu Herta Müller nicht von den Erfahrungen der Verfolgungen der Securitate geprägt. Vielleicht gelingt es ihr deshalb, uns ihre verlorene Heimat und die Menschen so nahe zu bringen.
---
Buchtipp von Alexandra Hausner:
Morenga (von Uwe Timm)
dtv, München 2020. 474 Seiten
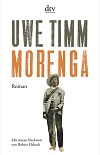
https://www.dtv.de/buch/uwe-timm-morenga-14761/
Dieses Buch ist eine Wiederentdeckung. Uwe Timm (*1940) hat Morenga zum ersten Mal 1978 veröffentlicht, als die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte noch nicht auf der offiziellen Agenda stand.
Zwar ist das Buch für den Unterricht zu umfangreich, durch die Montagetechnik Timms (historische Originaldokumente, Briefe und fiktive Aufzeichnungen) zu komplex und nicht immer leicht zu lesen, doch wer sich für das Thema interessiert ein Muss. Der Roman befasst sich mit der deutschen Kolonialgeschichte zwischen der Mitte des 19. Jhdts. und 1908 in Deutsch-Südwest, dem heutigen Namibia und besonders dem Herero-Aufstand. Er erzählt die fiktive Lebensgeschichte des Oberveterinärs Gottschalk, der trotz seiner wachsenden skeptischen Haltung gegenüber der deutschen Kolonialpolitik es nicht schafft, sich aus den bestehenden gesellschaftlich vorgeschriebenen Denkmustern zu befreien, der auf einen der wichtigsten Führer des Herero- und Nama-Aufstands Jacobus Morenga (1875 – 1907) trifft. Dass der Roman vor mehr als 40 Jahren veröffentlicht wurde, zeigt sich auch an der noch nicht korrekten politischen Sprachverwendung. Trotzdem ein Meilenstein in der Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte.
---
Buchtipp von Irmgard Soukup-Unterweger¹
Suchbild mit Katze (von Peter Henisch)
Deuticke, 2016
Peter Henisch schaut gern aus dem Fenster: "All die Fenster, aus denen ich schon geschaut habe. Nicht ganz wenige im Lauf eines Lebens. Die meisten in Wien und Umgebung, ein paar auch woanders. Fenster mit Blick ins Grüne oder ins Graue, Fenster mit und ohne Meerblick." (S. 10). Der Blick aus dem Fenster zieht sich wie ein Leitmotiv durch dieses Erinnerungsbuch. Es führt in das Wien der Nachkriegszeit, in dem der Autor seine Kindheit verbrachte. Er schaut jedoch nicht allein aus dem Fenster, sondern oft gemeinsam mit seiner geliebten Katze "Murli". Gemeinsam mit den Eltern und der schwarzen Katze mit dem weißen Fleck auf der Brust lebt er in einer halb zerstörten Wohnung. Das Haus hat einen Bombentreffer abbekommen und so wurde aus der Zweizimmerwohnung eine Einzimmerwohnung, bestehend aus dem "großen Zimmer" mit dem Erkerfenster, das als Ausguck dient, Vorzimmer, Küche und Kabinett. Das zweite Zimmer ist in den letzten Kriegstagen abgestürzt. Durch die verbliebene Tür zieht es im Winter eiskalt herein, liegt das Zimmer doch unten auf einer Schutthalde. Die kleine Familie des Fotografen - Peter ist das einzige Kind - ist froh, hier eine neue Heimat im 3. Bezirk gefunden zu haben, nachdem ihr ursprüngliches Wohnhaus völlig zerstört worden ist. Der Bub kniet viele Stunden des Tages auf einem Sessel und beobachtet das Leben und Treiben in den Gassen und Straßen unter ihm. Die Katze unternimmt ab und zu einen Ausflug auf das Sims, da sie die Tauben auf dem Dach des nahe gelegenen Kinos genauer in Augenschein nehmen will.
Die Kindheitserinnerungen sind nicht das einzige Thema des Buchs. Sie werden kunstvoll verknüpft mit der Zeitgeschichte, erzählt vom Großvater, mit dem er eine mehrtägige Wanderung unternimmt. Der Großvater ist zunächst wortkarg, beginnt aber nach und nach zu erzählen. So hält auch die Zeit der Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg Einzug in das Buch.
Das rein assoziativ aufgebaute Mosaik aus Erinnerungen und Zeitgeschichte, zugleich heiter und melancholisch erzählt, wird ergänzt durch den Blick aus Fenstern in Städten und am Meer, die der Autor auf seinen späteren Reisen getan hat. Dieser nicht chronologischen Erzählweise ist dennoch leicht zu folgen, da die späteren, näher an der Gegenwart angesiedelten Beobachtungen und Gedanken kursiv gesetzt sind.
Leicht lesbar ist das Buch besonders dank des sympathischen Plaudertons, dessen sich der Autor bedient. Er klagt nicht im Jammerton über eine schwere Kindheit im zerstörten Wien, sondern beschreibt seine Erinnerungen leichtfüßig und selbstironisch. Die Geborgenheit in der Familie, die Zuneigung zu Eltern und Großeltern prägen seine Kindheit. Eine seiner Großmütter ist eine Lesende, die andere - mütterlicherseits, aus Böhmen stammend - eine Erzählende. Der Autor belehrt nicht, sondern macht das Einzelkind mit seinen Nachbar- und Straßenfreundschaften in einer zutiefst menschlichen, ehrlichen und mitunter auch selbstkritischen Weise erlebbar.
Es ist wohl nicht zuletzt diese sympathische Offenheit, die neugierig auf die anderen autobiografischen Bücher des Autors macht. Hervorzuheben sind in dieser Hinsicht Die kleine Figur meines Vaters, aktualisierte Neuauflage, 2003, und Eine sehr kleine Frau, 2007 (über die "erzählende" Großmutter).
Autor: Peter Henisch, geboren 1943 in Wien, Schriftsteller; Journalist und Musiker
Leben, Werke und Auszeichnungen: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Henisch
---
¹ Irmgard Soukup-Unterweger ist Übersetzerin und Dolmetscherin für Russisch und lebt in Perchtoldsdorf bei Wien
Impressum Letzte Änderung: So., 7. Jan. 2024


